
Ich durfte vor Kurzem an einer Diskussionsrunde teilnehmen. Hier könnt ihr diese nachlesen. Wir sprechen über die metoo-Bewegung in Amerika und hier in Deutschland und wie uns die Debatte heute, drei Jahre nach dem Start im Privaten und auch im Arbeitsleben beeinflusst. Hat es uns überhaupt geprägt? Dafür gebe ich die Leitung der Diskussion an die Radiosprecherin Sina Peschke ab.
Sina Peschke (Radio MDR): Ich begrüße sie ganz herzlich zur Diskussionsrunde vom MDR Sachsen Radio. Der Hashtag #metoo hat vor drei Jahren eine weltweite Welle an Offenbarungen von sexuellem Missbrauch ausgelöst. Heute fragen wir uns, was diese Debatte bewirkt hat. Ist die Gesellschaft für Frauen gerechter geworden?
Wir sprechen unter anderem mit einem Missbrauchsopfer, das durch die metoo-Bewegung sein persönliches Schicksal endlich aufarbeiten konnte. Und wir fragen nach, wie #metoo die Filmbranche und das Arbeitsleben im Allgemeinen verändert hat.
Ich begrüße ganz herzlich die uns zugeschalteten Studiogäste: Das ist Jana Brandt, MDR Programmchefin für den Bereich Fernsehfilm. Sensibilisierung beim Umgang miteinander am Arbeitsplatz darüber sprechen wir.
Mai Nguyen, sie hat selbst sexuellen Missbrauch erlebt und den Mann, der sie missbraucht hat, vor Gericht gebracht. Sie erzählt uns hier ihre eigene #metoo Geschichte.
Thomas Buchmann ist bei uns. Leiter der Sportjugend im Landessportbund-Sachsen und Experte zum Thema Kinderschutz und Prävention bei sexueller Gewalt. Er ist außerdem Kinderschutzbeauftragter im sächsischen Judoverband.
Christina Stockfisch vom Deutschen Gewerkschaftsbund ist dort zuständig für europäische und internationale Gleichstellungspolitik. Sie wird im zweiten Teil auch dabei sein.
Katharina Wilhelm und Antje Passenheim sind bei uns. Beide sind ARD Korrespondentinnen. Antje Passenheim in New York und Katharina Wilhelm in Los Angeles. Sie erzählen von der jetzigen Situation in den USA.
Die Anklagen auf Harvey Weinstein haben das ganze Thema #metoo in Amerika ins Rollen gebracht. Hat sich dadurch auf lange Sicht etwas verändert?

Drei Jahre metoo-Bewegung. Wie hat die Debatte das gesellschaftliche Leben verändert? Wir haben eine Umfrage gemacht und gefragt, wie drei Jahre #metoo das persönliche Leben unserer Hörerinnen und Hörer beeinflusst hat.
Befragter 1: “Ja, ich denke, es hat schon was verändert. Zumindest hat es zum Nachdenken angeregt. Und selbst in der Familie, aber auch im Freundeskreis hat man darüber diskutiert. Ich finde es sehr mutig von den Frauen, dass sie sich geäußert haben und sich dazu bekannt haben, was ja nicht einfach ist vor allen Dingen, weil es auch berufliche Nachteile haben kann und es auch hatte.
Die Äußerungen der Frauen haben auch dazu beigetragen, dass manche Täter jetzt verurteilt wurden. Zumindest ist das meiner Kenntnis in Amerika. Hier, denke ich, ist es auch zu Aktionen gekommen, die dazu beitragen, das Selbstbewusstsein der Frauen zu stärken und vor allen Dingen die Leute über die Verhaltensweise der Männer nachdenken zu lassen.
Befragte 2: “Ob das für den einzelnen Betroffenen hilfreich war, kann ich nicht beurteilen, aber auf alle Fälle wird über ein existierendes Problem in der Öffentlichkeit gesprochen. Was ja schon einmal der richtige Anstoß ist, aber zu einer weniger frauenverachtenden Gesellschaft gehört eben noch viel mehr.”
Befragte 3: “Also ich weiß es nicht. Ich glaube, die Zahlen sprechen für sich. Selbst in Deutschland, in einer Großstadt wie Berlin, Frauen immer noch Angst haben, anzuzeigen oder sich damit bemerkbar zu machen. Da muss ich ehrlich sein, das finde ich schon traurig.
Es sollte auch mehr Solidarität unter Frauen geben. “Lass dir nichts gefallen!” Ich bin noch aus einer anderen Generation. Hab das natürlich auch mit meiner jüngeren Tochter besprochen. Wir müssen zeigen, dass das nicht geht. Ich hoffe, dass jungen Frauen oder den Frauen, denen so etwas passiert ist, der Rücken gestärkt wird. Dass der Gesetzgeber sofort sagt: “Nein, das geht nicht.” Das wäre mir am wichtigsten.”
Befragte 4: “ Um ehrlich zu sein, habe ich mich damit nicht großartig befasst, das ging an mir vorbei. Aber ich glaube auch nicht, dass sich was geändert hat. Ich denke, das ist so geblieben.
Befragte 5: “Ja, aber die Männer waren schon vorher super. Es hat sich etwas geändert. Ich sag mal so, wir sind frech zu den Männern, und die Männer sind auch manchmal frech zu uns Frauen. Alles im gesunden, angebrachten und im lustigen Rahmen. Unser Betrieb ist dafür zu klein.
Befragter 6: Ich denke mal, das sich das Verhältnis etwas gewandelt hat und es im Umbruch ist. Es hat allgemein in der Gesellschaft eine positive Resonanz gegeben.
Befragte 7: Von der Debatte habe ich noch nie gehört. Auch im Umkreis wurde das noch nie angesprochen. Also sind wir wahrscheinlich nie betroffen.
Befragter 8: Ich habe zu DDR Zeiten viel als Fotograf auf Großveranstaltungen gearbeitet. Was sich da so hinter der Bühne abgelaufen ist. Das war alles freiwillig. Da war nirgendwo Zwang dabei. Und das ist heute auch nicht anders, das kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen.
Befragter 9: Wenn ich früher mal eine unterm Arm hatte, habe ich auch mal an den Hintern gefasst und gesagt: “Weißt du eigentlich, was du für einen knackigen Po hast?” Da waren die stolz. Heute würden sie sagen: “Der hat mir an den Hintern gefasst. Er hat mich vergewaltigt.” Alles Müll.
Befragte 10: Bei uns überhaupt nicht. Wir arbeiten in der Kosmetik, da könnte ich überhaupt keine Veränderungen beim Verhalten gegenüber Frauen feststellen. Hier für uns habe ich nicht das Gefühl, dass das jetzt anders ist. Wie der Umgang mit Frauen in Büroräumen ist, kann ich nicht beurteilen.
Das sagen unsere Hörerinnen und Hörer zum Thema #metoo.
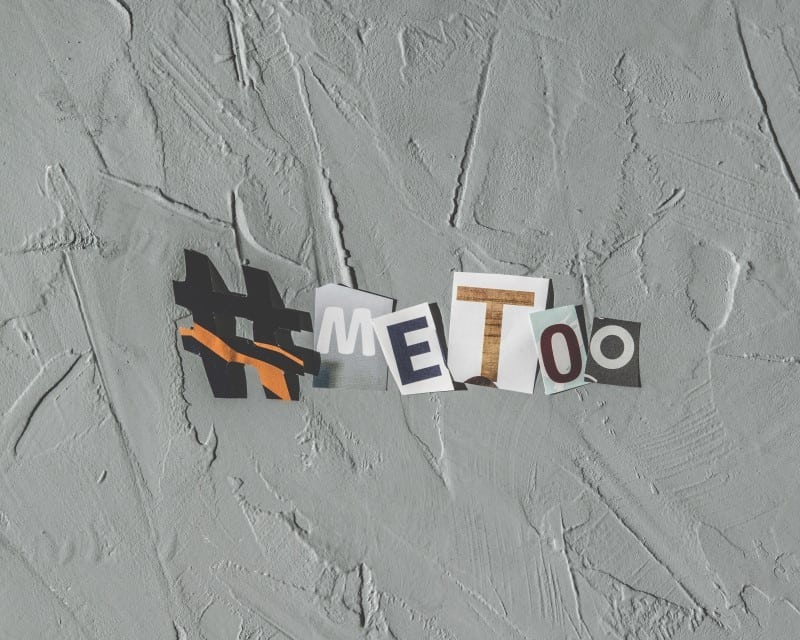
Sina Peschke (Radio MDR): Ich gebe jetzt mal die Frage in die Runde: Wie ausgeprägt ist denn sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz oder auch im ganz normalen Leben in Deutschland? Weil das ja angezweifelt wurde, dass es bei uns so ein großes Thema ist.
Brandt: Ich finde erst mal die Äußerungen der Befragten sehr interessant, weil sie ja eine Gesamtbreite widerspiegeln: Von: Das Thema ist bewusst, das Thema wird verdrängt, bis zu: Das Thema wird anders behandelt.
Damit auch die gesamte Bandbreite der damaligen Diskussion widerspiegelt, an die ich mich sehr genau erinnere. Als #metoo über Harvey Weinstein zu uns herüberschwappte, das ganze kein neues Thema war, sondern es nun eine Öffentlichkeit gab für etwas, worüber wir vielleicht alle zu selten miteinander gesprochen haben.
Zu der Frage, ob sich was verändert hat und wie der heutige Stand ist. Hat sich, glaube ich, etwas verändert, weil es hat sich ein anderes Bewusstsein aufgebaut. Alleine das auch in ihren Beiträgen es Männer wie Frauen gibt, die sagen, sie haben sich damit beschäftigt. Die sich mit ihren Kindern zu diesem Thema auseinandergesetzt haben. Die eigenen Regeln oder was in der eigenen Generation womöglich nicht richtig abgelaufen ist, hinterfragt.
Wo wir vorher nicht so intensiv darüber gesprochen haben im privaten wie auch im beruflichen Umfeld, wird sich jetzt darüber geredet. Alleine, dass wir realisiert haben, dass wir auch darüber miteinander sprechen und es thematisieren, finde ich die größte Veränderung, die ich sehr wohl auch am Arbeitsplatz bemerkt habe, aber auch im privaten Umfeld.

Radio: Frau Passenheim. Sie arbeiten im ARD-Studio in New York. Sie sind ganz nah an dem Thema dran. Noch ursprünglicher als wir hier, wenn es um den Prozess geht. Wie empfinden Sie drei Jahre danach?
Passenheim: Ja, es begann alles hier in New York, mit einem Artikel in der New York Times, in dem mutige Schauspielerinnen und Mitarbeiterinnen dem Filmproduzenten Harvey Weinstein sexuelle Belästigung vorwarfen. Viele Karrieren waren für diese Frauen offenbar erst dann möglich, wenn sie ihm gefällig waren.
Eine der Frauen, die Schauspielerin Alyssa Milano, hat dann getwittert und dazu aufgerufen, das Frauen und auch Männer, die sexuell belästigt oder angegriffen worden sind, mit #metoo, ich auch, auf diesen Tweet zu antworten.
Daraufhin antworteten Millionen von Menschen aus der ganzen Welt. Die Debatte wurde angestoßen. Mein persönlicher Höhepunkt der Debatte war dann der darauf folgende Prozess gegen Harvey Weinstein, der mehr als nur ein Prozess war.
Denn er war für viele Frauen hier in den USA, und ich denke auch weltweit ein Symbol dafür, dass eine Zeit vorbei ist. Nämlich die Zeit, in der Taten wie die, die dort zur Debatte standen: sexuelle Belästigung, sexuelle Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung noch keine Chancen zu Gerechtigkeit hatten.
Diese Taten nun ernst genommen werden. Kein Täter mehr so davonkommt, egal wie lange sie her sind, wie weit sie zurückliegen und egal, wie prominent der Täter ist.
Die Zeit der Weinsteins ist vorbei, die Zeit der metoo-Bewegung noch nicht.

Sina Peschke (Radio MDR): Wir müssen uns vielleicht noch mal darüber unterhalten, was sexuelle Belästigung, das sagt man immer so schnell eigentlich bedeutet. Wo fängt es an? Wo hört das auf? Weil sie den Weinstein Prozess begleitet haben? Kennen Sie sicherlich auch die Definition?
Passenheim: Sexuelle Belästigung beginnt da, wo sexuelle Taten sexuelle Annäherung an jemanden passieren, der in dem Fall von #metoo, eines Mächtigen unterlegen ist. Wo sich ein Mächtiger, ein Vorgesetzter, ein Überlegener an Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern sexuell vergreift.
Das dann davon abhängig macht, beruflich weiterzukommen. Das ist erst einmal die Definition dieser sexuellen Belästigungen in der metoo-Bewegung.
Radio: Dazu gehören natürlich auch sexuelle Bemerkungen. Das muss man vielleicht auch dazusagen.
Passenheim: Genau dazu gehören auch Anmerkungen wie: “Du hast einen knackigen Po.” Oder: “Du hast ein sexy Kleid an.”

Sina Peschke (Radio MDR): Herr Buchmann, trifft diese Definition jetzt auch auf sie im Sport zu? Arbeiten sie mit dieser Definition. Sie sind Leiter der Sportjugend im Landessportbund Sachsen.
Thomas Buchmann: Es gibt von dem Thema sexualisierte Gewalt, sexuelle Belästigung, ein weites oder ein enges Begriffsverständnis. Wir arbeiten im Sport damit, dass wir die Bereiche auch im nonverbalen Bereich, beziehungsweise auch Bemerkungen schon allein durch Worte und Gesten dazugehören.
Das sich erniedrigend zur äußern, eine Form von sexualisierter Gewalt ist.

Meine 3 Gründe
Radio: Mai Nguyen hat sexuellen Missbrauch selbst erlebt. Die metoo-Bewegung hat ihr die Motivation und die Kraft gegeben, ihre Geschichte aufzuarbeiten. Letztendlich hat sie den Mann, der sie missbraucht hat, vor Gericht gebracht. Frau Nguyen, erzählen sie uns ihre Geschichte.
Mai Nguyen: Ich bin 28, und bei mir war es, ich sag mal, der Klassiker. Der nette Freund der Familie, der mir noch nie so richtig geheuer war. Als ich acht Jahre alt war, hat er sich das erste Mal an mir vergriffen.
Wir haben in so einem klassischen Reihenhaus gelebt. Ich wollte nur kurz hoch in mein Zimmer, welches ganz oben unterm Dach war, und er war im Büro. Meine Eltern waren auf Arbeit. Ich wollte quasi nur kurz vorbei und weil ich ein sehr neugieriges Kind war, habe ich kurz geschaut, was der Onkel da gerade so macht.
Habe meinen Kopf in die Tür gesteckt und direkt gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt, wollte eigentlich wieder abhauen. Dann hat er mich aber hereingerufen. Hat sich sehr schnell herausgestellt, was nicht stimmt. Er saß am PC meines Vaters und hat sich Pornos angeguckt, und ich habe das mit acht natürlich noch nicht so richtig verstanden, was dort passiert. Wusste aber, dass hier irgendwas nicht richtig ist.
Ich war aber volle Kanne im “freeze” Mode, wie ich heute weiß. Also, ich war einfach nur noch am Funktionieren, es war gefährlich, irgendwas stimmte nicht und ich habe einfach alles getan, was er mir gesagt hat.
Das lief über mehrere Jahre. Als ich 14 war, kam es zum letzten Übergriff. Er hat zum Glück nicht in der Nähe gewohnt, sondern es war so ein typisches: Familien besuchen sich so ein, zweimal im Jahr. Jedes Mal, wenn er zu Besuch war oder wir bei ihm waren, ist er übergriffig geworden.
Heute weiß ich es. Früher wäre ich mir nicht so sicher gewesen. Gerade bei der Begriffsdefinition. Was ist da jetzt genau passiert? War das jetzt übergriffig? War das jetzt schlecht? Ist das jetzt ein Missbrauch? Ist das eine Vergewaltigung? Das weiß man ja nicht als Nichtjurist.
Mittlerweile habe ich jetzt dadurch, dass er verurteilt worden ist, auch den Juristen Slang drauf und weiß, dass das ein schwerer sexueller Missbrauch Minderjähriger in Tateinheit mit Vergewaltigung war.
Hier kannst du die gesamte Geschichte nachlesen.

Sina Peschke (Radio MDR): Sie haben gerade gesagt, dass es mehrmals passiert ist. Wie lange haben Sie dieses Geheimnis für sich behalten können?
Mai Nguyen: Acht war ich beim ersten Übergriff. Angezeigt habe ich mit 25 Jahren.
Radio: Für Außenstehende ist es immer schwer, sich vorzustellen, wie das geht, jahrelang nicht darüber zu reden. Warum haben Sie nicht mit ihrer Mutter gesprochen? Oder einer Freundin? Das ist der erste Gedanke, der einem dabei kommt.
Mai Nguyen: Kann ich total gut verstehen. Bei mir war es so, dass ich tatsächlich wenige Male versucht habe, mir Hilfe zu holen. Dabei muss man aber auch verstehen, das weiß ich auch erst heute, als Erwachsene.
Kinder holen sich viel subtiler Hilfe, viel subtiler Zeichen geben. Ich war zum Beispiel, ich habe es vorhin erwähnt, ein sehr neugierig, sehr quirliges, sehr aktives Kind und bin quasi von einem auf den anderen Tag ganz ruhig geworden, ganz in mich gekehrt gewesen.
Wer heute solche Zeichen kennt, wer sich damit beschäftigt, weiß, da könnte etwas sein. Meine Eltern waren sehr beschäftigt. Sie haben beide in Vollzeit gearbeitet. Ich mache Ihnen absolut keine Vorwürfe, dass sie da das Auge und den Blick und die Energie nicht für hatten.
Sina Peschke (Radio MDR): Hatten sie das Bedürfnis, zu reden? Oder vielleicht war das ja gar nicht da?
Mai Nguyen: Ja, ich hatte das ganz stark. Es kam aber nichts über meine Lippen. Ich war auch mehrere Jahre in Psychotherapie, nachdem ich angezeigt habe. Erst da habe ich verstanden, warum.
Man macht sich ja als Opfer selber Vorwürfe. “Ich hätte doch was sagen können.”, “Ich hätte doch weglaufen können.”, “Ich hätte doch schreien können.”, “Ich hätte doch zumindest danach meinen Eltern erzählen können.”. Aber da waren Schweigegelübde. So nannte das meine Therapeutin.
Ein ganz klassisches Täterverhalten, um sich selber zu schützen und die Tat zu decken, ist dem Opfer zu sagen, dass es nicht darüber sprechen darf. Genau das ist geschehen.
In der Regel, gerade bei Kindern, die viel beeinflussbarer sind, ist dann auch der Faktor da, wenn er droht: “Wenn du das wem erzählst, dann passiert was ganz Schlimmes.”. Als Erwachsene denken wir uns, was soll schon passieren.
Aber als Kind ist die Fantasie riesengroß. Da könnte alles passieren. Man malt sich alles aus. Drohungen wie: “Wenn du es deiner Mama erzählst, dann weiß sie, dass du etwas ganz Schlimmes getan hast. Dann kriegst du Ärger.”
Täter und Opfer verdrehen. Schon in der Drohung. Ich habe nichts Schlimmes getan, sondern er aber das weiß ich ja als Kind nicht.

Radio: Ich darf sie zitieren. “Mein größter Zusammenbruch war auch mein größter Durchbruch.” Was meinen Sie damit?
Mai Nguyen: Ich meine damit, dass ich mein Leben lang mit einer verdeckten posttraumatischen Belastungsstörung herumgelaufen bin. Ich hatte die Erinnerung an die Tat, also bei mir war es keine Amnesie, sondern ich habe es verdrängt.
Es ist immer mal wieder über Trigger Themen hochgekommen, und dann hat sich alles in mir einmal zusammengezogen.
Sina Peschke (Radio MDR): Was meinen Sie mit posttraumatischer Belastungsstörung? Wie hat sich das geäußert?
Mai Nguyen: Das hat sich zum Beispiel daran in einer ganz starken Ruhelosigkeit geäußert. Ich konnte keine zwei Minuten still sitzen. Ich musste immer machen, machen, machen. Und ich habe das ganz lange als Teil meiner Identität gesehen.
Ich dachte, so bin ich. Ich bin halt ein sehr aktiver Mensch und mache gern zehn Sachen gleichzeitig. Habe ein duales Studium, mach drei Ehrenämter und bin in der Gewerkschaft tätig. Mache fünfmal die Woche Sport.
Ganz viel Ablenkung. Weglaufen. Hauptsache keine zwei Minuten mit mir und meinen Gedanken alleine sitzen, weil da vielleicht irgendwas an alten Erinnerungen hochkommen könnte.
Radio: Dann kam irgendwann die metoo-Bewegung. Wie alt waren sie da?
Mai Nguyen: Da war ich 25 Jahre.
Sina Peschke (Radio MDR): Was genau war der Auslöser, das sie gesagt haben: “Jetzt bringe ich ihn vor Gericht.”?
Mai Nguyen: 2016 gab es in den Medien eine ganz große Debatte um die Teilnehmerin von "Germanys next Topmodel", Gina Lisa Lohfink. Ganz unabhängig davon, was man von dem Format hält, habe ich das Gefühl gehabt, ich sei da total mitgefahren.
Für mich war die Lage sehr klar. Es gab ein Video davon. Die Frau hat auf dem Video “Nein” gesagt. Sie wirkt auf dem Video nicht, als ob sie wirklich da wäre. Und für mich war total klar: Die Typen werden verurteilt. Ich bin da emotional total mitgegangen. Ich hatte vorher ganz viel Angst vor der Justiz und hatte überhaupt kein Vertrauen darin, weil man kennt die Zahlen, wie die Verurteilungen sind.
Man hört ganz viel Negatives davon, wie die Polizei mit einem umgeht. Habe mich da irgendwann so reingehängt, dass ich mir gesagt habe, wenn die beiden Männer verurteilt werden dann habe ich wieder Vertrauen in Justiz, dann zeige ich auch an.
Das ist aber nicht geschehen. Die beiden Männer wurden freigesprochen. Das war für mich mein erster kleiner Zusammenbruch, wo ich die Welt nicht mehr verstanden habe. Ich war so wütend. Ich habe gegoogelt und gelesen, und ich dachte, dass das doch nicht sein kann. Das ist doch so klar.
Nach dieser Wutphase und dieser Verzweiflung kam dann der Moment, wo ich dachte: “Jetzt erst recht.” Die Trotzphase. Ich probiere es jetzt trotzdem, weil ich könnte mir später nicht in die Augen sehen mit der Frage: Was wäre wenn. Was wäre, wenn er dadurch, dass ich nicht angezeigt habe, sich vielleicht weiter an anderen Kindern vergehen kann?
Da habe ich beschlossen, ich möchte diesen Kampf und diesen Weg gehen. Ich weiß ja bei der Anzeige nicht, ob ich die Erste bin, die ihn anzeigt oder die Zehnte.

Radio: Der Mann hat eine Bewährungsstrafe erhalten. Finden Sie das gerecht?
Mai Nguyen: Das ist eine etwas längere Geschichte. Ich mache sie kurz: Ich habe auf Bewährung plädiert.
Sina Peschke (Radio MDR): Ach so. Warum?
Mai Nguyen: Jetzt wird es doch ein bisschen lang. Sie haben gefragt. Also es ist so, dass ich ihn tatsächlich all die Jahre, seit ich 14 bin, nicht mehr gesehen habe. Während der Prozess vorbereitet wurde, hat sein Anwalt versucht, meine Anwältin zu kontaktieren und um ein klärendes Gespräch gebeten.
Ich habe abgelehnt und gesagt, ich habe nichts mit diesem Mann zu besprechen. Ich sehe ihn, wenn vor Gericht. Das ist dann tatsächlich auch letztes Jahr im September geschehen.
Es waren fünf Verhandlungstage angesetzt, und ich habe mir 10 Millionen Szenarien ausgemalt, wie das hätte aussehen können. Wie unser erstes Zusammentreffen hätte aussehen können.
Radio: Und wie war es?
Mai Nguyen: Keines meiner Vorstellungen ist eingetroffen. Keines. Ich laufe über diesen Gerichtsflur ganz klischeehaft: superaltes Gebäude. Das ist das Lüneburger Landgericht gewesen.
Laufe über diesen Linoleumboden so ein bisschen dreckig, süffig. Sehe dann den Mann vor dem Gerichtssaal an der Tür stehen. Der Saal war noch zu und ich merke nur, wie alles in mir zu macht. Ich will ihn nicht sehen. Ich will nicht mit ihm reden, und ich hab mich umgedreht.
Fünf Meter, bevor wir aufeinandergetroffen wären, habe ich mich umgedreht. Mein Partner war dabei und habe dann quasi so getan, als ob ich mich mit ihm unterhalte und ihm den Rücken zugedreht, das sich auf keinen Fall mit ihm reden muss.
Was dann passiert ist, habe ich niemals erwartet. Er ist auf mich zugekommen. Er ist respektvoll, mit Abstand um mich herumgelaufen und ist vor mir auf die Knie gefallen und hat angefangen, um Verzeihung zu bitten, hat seine Taten gestanden, hat gesagt, dass es ihm unglaublich leidtut, dass er sich bis heute Vorwürfe macht, dass er nicht versteht, was er da getan hat, warum er das getan hat, und er bittet um Verzeihung.
Sina Peschke (Radio MDR): Reicht das?
Mai Nguyen: Das habe ich mich auch gefragt. Sehr lange sogar. Ich hatte ja fünf Verhandlungstage, die über drei, vier Wochen verteilt waren. Für mich war dann zum ersten Mal auch die Option offen, mit ihm an einen Tisch zu gehen. Das haben wir getan. In Absprache mit meiner Anwältin und seinem Anwalt.
Wir sind in einen Meditationsraum mit einem Mediator vom Gericht und einem Dolmetscher. Er spricht Vietnamesisch. Haben dann gesprochen, und ich durfte und konnte alle meine Fragen stellen, alle Fragen, die mich all die Jahre beschäftigt haben.
Man kann das rational nicht erklären. Ich habe aber gespürt, dass er ehrlich zu mir ist. Dass er selber komplett zerfressen ist. In dem Moment, indem er damals im Gerichtsflur vor mir auf die Knie gefallen ist, ist dieses ganze Bild vom großen Monster, von diesem übermächtigen Mann, ich meine, der war damals doppelt so groß wie ich. Dieses Bild ist komplett zusammengefallen.
Ich habe nur noch dieses Häufchen Elend vor mir gesehen, das ganz andere Probleme hat.

Radio: War die metoo-Bewegung für sie die Erlösung?
Mai Nguyen: Es war schon sehr heilsam, ja. Ich habe zum ersten Mal gemerkt: Ich bin nicht alleine. Ich bin all die Jahre herumgelaufen und dachte, dass es nur mir so geht. Nur ich habe das erlebt. Ich bin ganz alleine.
All diese Gefühle, diese Scham, diese Angst, diese Schuld, sich damit so alleine zu fühlen war, glaube ich, für mich eines der schlimmsten Erlebnisse.
Man spricht ja von primärer und sekundärer Traumatisierung. Die Primäre ist das, was während der Tat passiert und die Sekundäre, was dann danach passiert. Die Reaktion des Umfeldes, aber auch die eigenen psychischen Reaktionen.
Und ich würde sagen, dass die Sekundäre für mich viel schlimmer war, weil die Tat selber ist irgendwann vorbei.
Sina Peschke (Radio MDR): Geht es ihnen jetzt gut?
Mai Nguyen: Mir geht es heute richtig gut, ja.
Sina Peschke (Radio MDR): Ich danke ihnen erst mal für diese Geschichte.

Radio: Begonnen hat das Ganze ja in der US-Filmbranche. Der Produzent Harvey Weinstein wurde angezeigt und Anfang des Jahres zu 23 Jahren Haft verurteilt. Darauf gehen wir später noch einmal detailliert ein.
Wir schauen jetzt erst mal auf die deutsche Filmbranche und zu Jana Brandt. Jana Brandt ist MDR Programmchefin im Bereich Fernsehfilm. Sie konzipieren und produzieren Filme und Serien wie zum Beispiel “In aller Freundschaft”, “Weißensee”, “Bornholmer Straße”, “Der Turm Charite”, sie sind auch für die Tatorte zuständig, aus Dresden und aus Weimar.
Das heißt, unter vielen erfolgreichen deutschen Fernsehproduktionen steht im Abspann ihr Name. Ist denn sexuelle Belästigungen auch schon Thema in ihren Produktionen gewesen?
Jana Brandt: Eine sehr konkrete Frage, die so nicht zu beantworten ist. Ich würde gerne etwas weiter ausführen wollen. Am Beginn von #metoo und der Frage, die sie ganz am Anfang gestellt haben.
Was sich in Deutschland in diesem Punkt verändert hat? Die Debatte war für mich, die diesen Beruf als Macherin schon lange ausübt, aber auch als Führungskraft in einer Personalverantwortung sehr bedeutend.
Vor allen Dingen auch für viele junge Frauen war es interessant, das, obwohl wir schon lange die Jobs in der Redaktion miteinander machten, das erste Mal auch wir miteinander über Arbeitsumfelder geredet haben.
Über das eigene Arbeitsumfeld, über das Erleben am Arbeitsplatz, was nicht so viel anders als in einem normalen Büro ist, weil wir auch in einem Büro Umfeld sind. Gleichzeitig aber auch Verantwortung für unsere Auftragsproduktionen tragen, wo wir nicht vor Ort sind, aber Teil sind.
Ich erinnere mich sehr genau an diese Phase, wo man einerseits fasziniert, zum Teil angewidert, zum Teil ermutigt, je nachdem, aus welcher Perspektive man auf die Ereignisse in die USA geschaut hat.
Leute, Mitarbeiter/innen machten sich bereit, über ihre Erfahrungen im Arbeitsprozess zu sprechen. Diese Diskussionen sind sehr unterschiedlich gewesen. Vom respektvollen Miteinander, von ganz tollen Arbeitserlebnissen aber auch zu Situationen, die schwer einzuordnen waren, zu unterschiedlichen Punkten.
Die zu keinem Zeitpunkt mit sexueller Gewalt zu tun hatten. Eher unterschwellig, wie man behandelt wird, wenn man als junge Frau in ein Arbeitsteam kommt. Wie und von wem. Von oben herab. Wie beiläufig sind Bewegung oder Bemerkung.
Das war eine sehr spannende Phase auch für uns, weil ich ein sehr offenes Arbeitsklima diesbezüglich gespürt hatte. Auch bei uns in der Redaktion. Wir sind viele Frauen, worauf ich sehr stolz bin, weil ich auch viele Frauen gefördert habe, in dieser Funktion und ihnen die Chance gegeben habe, in ein sozusagen männlich dominiertes Feld einzutreten.
Dann haben wir auf unsere Produktion geschaut, da schließt sich jetzt auch ihre Frage an. Wir haben lange darüber diskutiert, wie wir mit unseren Produktionsfirmen, die für uns in Auftragsproduktion für den MDR, aber auch “Das Erste” produzieren, in ein Gespräch kommen wollen.
Haben Diskussionsrunden mit unseren Produzenten gemacht, die wir in dem #metoo Gedanken weiter gefasst haben. Ich erinnere mich, dass wir damals eingeladen haben, im MDR, wie wir miteinander arbeiten wollen.
Haben in dieses, wie wir miteinander arbeiten wollen, das Thema #metoo integriert. Aber nicht ausschließlich, weil wir in dem reflektieren, wie das Arbeiten miteinander ist, aber auch im fiktionalen Umfeld unserer Auftragsproduktionen.
Wir hatten keinen Fall von sexueller Gewalt, sexuellem Missbrauch, wie sie in ihrem Beispiel beschrieben hatten, sondern wir haben uns angeschaut: Wie verhält man sich in Buchbesprechung? Wer sitzt wo? Wie scheinbar beiläufig geht eine Hand, von wem auch immer, wohin auch immer?
Wir hatten Themen, die mit Respekt am Arbeitsort in unseren Produktionen zu tun hatten. In der Frage von Hierarchien. Wer missbraucht Macht? Egal wie. Auch wenn es nur "sich im Ton vergreifen" ist.
Wir hatten viele Themen, die glaube ich, für diese Branche gar nicht typisch sind, sondern im Arbeitsumfeld manchmal beiläufig sind. Von wegen, es ist doch normal, das ist doch so, dass gehört doch zum Arbeiten miteinander. Haben versucht, #metoo zu integrieren wie wir miteinander arbeiten wollen.
Sina Peschke (Radio MDR): Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie sich selbst sensibilisiert.
Jana Brandt: Genau.

Sina Peschke (Radio MDR): Ich habe den Eindruck, dass sie in ihrer Position #metoo sogar verhindern können?
Jana Brandt: Ja, auf jeden Fall. Indem diese offene Arbeitsatmosphäre geschaffen wird. Das Gefühl, miteinander Informationsketten auch zu schaffen, eine Awareness dafür, wenn etwas passiert.
Eine Offenheit im Umgang damit, wenn jemand ein Problem hat, egal ob Mann oder Frau zu wissen, an wen sie sich wenden können. Wer sind die Ansprechpartner? Das sind alles Fragen, die es so in dieser Zeit in den Filmteams nicht klar geregelt gab.
Insofern diese Klarheit auch in Arbeitsabläufen zu schaffen. Informationsketten. Und damit ist auch präventiv damit umzugehen. Wie ich finde eine der größten Errungenschaften, um das abzuschließen.
Auch in unseren Verträgen sind heute Klauseln gegen sexuelle Gewalt und Belästigung explizit in jedem unserer Auftragsproduktionen drin. Das war vorher so explizit nicht. Also es hat sich viel verändert, auch in der Prävention.
Sina Peschke (Radio MDR): Das ist jetzt in Leipzig bei ihnen so. Haben sie einen Überblick über den Rest Deutschlands?
Jana Brandt: Nein, also den Überblick habe ich nicht. Aber zum Zeitpunkt, als wir uns alle, egal in welcher Branche wir gearbeitet haben, mit der metoo-Bewegung beschäftigt haben, hat sich natürlich auch die Filmbranche explizit damit beschäftigt.
Ich weiß, dass viele Kollegen aus anderen Häusern und Sendeanstalten sich genau damit explizit beschäftigt gehabt haben. Heute muss man sich das so vorstellen: Die neu zusammengewürfelten Teams, die eine Produktion starten und sich zum Teil nicht kennen, einen Abend zusammen sind und eine Arbeitseinweisung bekommen.
Dinge, die mit dem Arbeitsumfeld ganz klar zusammengehören und in diesen Auftaktveranstaltungen gehört das gegenseitige Beteuern und Einschwören auf den Kodex der Vermeidung der sexuellen Gewalt und Belästigungen dazu.
Gleichzeitig dem Klarmachen von Referenzen, an wen man sich zu wenden hat. Das gab es vor ein paar Jahren nicht. Insofern hat sich, so glaube ich, in Richtung Prävention auch etwas getan.

Radio: Vor #metoo, im Jahr 2017 gab es ja auch den ein oder anderen Fall, der erst jetzt ans Licht gekommen ist. Zum Beispiel der Fall vor drei Wochen, wo die Schauspielerin Jany Tempel an die Öffentlichkeit gegangen ist, weil sie für den anstehenden Prozess gegen den Regisseur Dieter Wedel Geld benötigt, das sie nicht hat.
Deshalb sammelt sie über eine Crowdfunding Plattformen Geld für das Anwaltshonorar. Sie wirft Wedel vor, sie bei einem Vorsprechen vergewaltigt zu haben. Kein Geld, keine Gerechtigkeit. Ist das immer noch so?
Jana Brandt: Das ist eine Zuspitzung der Frage in dem konkreten Fall, den ich auch nur aus der Presse kenne. Es ist ein konkretes Erfordernis, um in einen längeren Prozess eintreten zu können. Gleichzeitig eine hohe Solidarität, die ich bemerkenswert findet, dieses auch zu ermöglichen. Den langen Atem zu haben.
Vor Gericht auch für Gerechtigkeit zu streiten.
Sina Peschke (Radio MDR): Wie war das denn in New York? Frau Passenheim, wie viel Geld war da im Spiel? Konnten, dass wirklich nur Künstlerin machen, die einen finanziellen Background hatten?
Passenheim: Der finanzielle Background spielte mit Sicherheit auch eine Rolle. Was auch eine Rolle spielte, ist, dass viele Täter wie Harvey Weinstein ihre Opfer zum Schweigen gebracht haben.
Systematisch über viele Jahre. Deshalb hat es auch so lange gedauert, bis dieser Prozess ins Rollen gekommen ist. Durch sogenannte Schweigevereinbarungen, wo den mutmaßlichen Opfern sehr viel Geld dafür gegeben wurde, dass sie sich verpflichtet haben, ihr Leben lang zu schweigen.
Selbst vor Familienangehörigen. Vor ihren eigenen Männern, Kindern, Müttern, Vätern nicht darüber zu reden. Das ist auch eine praktische Folge dieses Weinsteines Prozesses, wo viele Bundesstaaten in den USA entschieden haben, dass solche Vereinbarungen nicht mehr zugelassen werden.
Opfer müssen, egal wie lange die Tat zurücklegen, in der Lage sein, darüber zu reden, was Täter mit ihnen gemacht haben. Das Geld hat natürlich viele gelockt, sich zu solchen Vereinbarungen auch überhaupt hinreißen zu lassen.
Sicherlich spielte Geld eine Rolle. Sicherlich spielte die Prominenz der Opfer eine Rolle, die sich dadurch gegenseitig Stärke gegeben haben und gezeigt haben, dass sie zusammenhalten und für alle sprechen.
Das ist auch die Forderung der #metoo Gründerinnen. Das waren jetzt die prominenten Fälle. Es gibt sehr viel mehr Fälle, die sind nicht so prominent. So viele Leute, die nicht so mächtig, berühmt und reich sind. Dass die genauso die Chance haben, damit durchzukommen. An diese Menschen müssen wir uns jetzt richten.
Was mir auch eben noch durch den Kopf ging, als ich die sehr eindrucksvollen Schilderungen von Mai Nguyen gehört habe, dass dieser Prozess, der hier in New York passiert und abgelaufen ist, allen Opfern in aller Welt gezeigt hat, das ihre Vorwürfe vor einem Strafgericht Bestand haben sollten.
Das wird nicht einfach nur gehört und dann weggewischt, sondern es hat vor einem Strafgericht Bestand, auch wenn diese Vorwürfe zum Teil schon so viele Jahre zurückliegen. Sie verjähren einfach nicht.
Sina Peschke (Radio MDR): Frau Nguyen, darf ich sie darauf ganz kurz etwas fragen? Inwiefern war bei ihnen Geld von Bedeutung? Brauchten sie Geld, um vor Gericht zu gehen? Oder haben Sie mit einer Prozesskostenbeihilfe geschaffen?
Mai Nguyen: Ich brauchte kein Geld. In Deutschland gibt es sogenannte “Opferanwälte” und ich war auf Landesebene, wir haben ja mehrere Gerichtsebenen. Bis zu einem gewissen Grad ist das für Opfer kostenlos, wenn sie eben bestimmte Anträge stellen. Diese können die Anwälte in der Regel stellen.
Bei der Jany Tempel ist es eben einfach schon sehr viel höher gewandert.
Sina Peschke (Radio MDR): Deshalb braucht sie das Geld genau?
Mai Nguyen: Genau.

Sina Peschke (Radio MDR): Antje Passenheim ist ARD Korrespondentin in New York. Frau Passenheim, mit dem Urteil gegen den amerikanischen Filmproduzenten Harvey Weinstein am Anfang des Jahres 2020 ist endlich ein Zeichen gegen Machtmissbrauch und sexuellen Missbrauch gesetzt worden.
Der Mann sitzt jetzt für 23 Jahre im Gefängnis. Sie waren beim Prozess in New York dabei, und sie sagen, fast nichts hat sie in ihrer Laufbahn als Korrespondentin mehr geprägt als diese Zeit. Warum?
Antje Passenheim: Es war jedenfalls eine der bewegendsten Ereignisse, die ich hier mitverfolgen konnte. In ihrer Tragik, Brutalität, in der Traurigkeit dieses Prozesses, aber auch manchmal in der Zerrissenheit.
Denn ich muss sagen, niemand hat sie beneidet um dieses Urteil. Denn es war durchaus so, dass die Beweise nach all den Jahren nicht klar auf der Hand lagen. Da gab es sehr viele Grauzonen. Trotz solcher Grauzonen gibt es am Ende ein Urteil für Täter wie Harvey Weinstein. Von den mehr als 80 Frauen, die Weinstein sexuelle Übergriffe, zum Teil Vergewaltigung vorwerfen, fanden sich gerade mal zwei Frauen, die ihre Fälle durchfechten konnten oder wollten.
Das war Schauspielerin Jessica Mandy, die er vergewaltigt hat, und seine Ex Assistentin Mimi Haleyi, die er sexuell genötigt hatte. Die anderen Fälle waren zum Teil verjährt, die Frauen hatten sich auf einen Deal mit Weinsteins Angestellten eingelassen oder die Fälle waren nicht justiziabel.
Auch diese beiden Fälle, die hier in New York vor Gericht waren, waren längst nicht so eindeutig, wie sie zunächst aussahen. Denn beide Frauen hatten auch vorher einvernehmliche Begegnung mit Weinstein, auch sexuelle Begegnung, die sie auch freiwillig hatten. Sie hatten lange freundschaftliche Kontakte zu ihm.
Diese Opfer zu erleben, die Qual zu spüren, über das zu sprechen, wann das Ganze gekippt ist, was ihnen widerfahren ist, zum Teil unter Tränen, war mehr als bewegend. Aber auch diesen tiefen Fall dieses mächtigen Mannes zu verfolgen, der sich am Ende gebückt und krumm auf seinen Rollator gestützt durch diese Reporter Trauben schob.
Bewegend auch, weil dieser Mann Harvey Weinstein bis zum Ende gezeigt hat: “Ich fand mein Verhalten normal. Ich habe nichts getan. Ich habe niemandem zu irgendetwas gezwungen. Ich habe nichts falsch gemacht.”
Und das ist ja genau die Haltung, die viele in der Situation haben. Genau damit ist er eben diesmal nicht durchgekommen.

Sina Peschke (Radio MDR): Wie wirkt denn dieses ganze Urteil nach? Beziehungsweise, was hat sich nach der Anklage schon in den letzten Jahren in den Staaten getan? Hat sich überhaupt was getan? Hat sich großartig was verändert? Was verspüren sie da?
Antje Passenheim: Erst mal haben sich viele Opfer ermutigt gefühlt, sich auch zu melden. Es steht bereits der nächste Prozess gegen Harvey Weinstein in Kalifornien an. Es hat sich in der Entertainmentindustrie jede Menge getan.
Frauen trauen sich zu, sich zu wehren. Sie haben die Chance, dass sie gehört werden. Es hat sich auch praktisch was getan, bei den vorher schon genannten "Schweigevereinbarungen" zwischen Tätern und Opfern, wo den Opfern Geld bezahlt wird, damit sie sich nicht zu Worte melden. Das haben viele Bundesstaaten verboten. Zum Beispiel auch hier in New York.
Es gibt einen Folgehashtag von #metoo, den #timesup also: Die Zeit ist rum. Die haben einen Rechtshilfefonds für Frauen und Männer für Opfer von #metoo geschaffen, die einfach Geld für die juristische Unterstützung brauchen.
Die Diskussion geht weiter. Eine der Mitgründerinnen von #metoo, der wir sozusagen den Hashtag zu verdanken haben, stammt aus dem Jahr 2006 von Tarana Burke. Die sich dafür eingesetzt hat, dass der sexuelle Missbrauch von Afroamerikanerin mehr ans Tageslicht kommt.
Die hat gesagt, dass es noch nicht das Ende der metoo-Bewegung ist. “Harvey Weinstein war ein Symbol. Der mächtige weiße Mann konnte verurteilt werden. Andere müssen es jetzt auch.”
Wir müssen über dieses Thema reden, die solche Verbrechen möglich machen. Verbrechen wie sexueller Machtmissbrauch am Arbeitsplatz, darum geht es ja hier und dafür müssen die Systeme verändert werden. Darüber haben wir ja eben schon gesprochen. Da ist auch in Deutschland durch die metoo-Bewegung einiges in Aktion gekommen.
Radio: Da war dieser Kinofilm “Bombshell” mit Nicole Kidman und Charlize Theron. Die Geschichte von “Fox News” einem Fernsehsender und dem Chef Roger Ailes. Hat diesen Film zufällig einer von unseren Gästen gesehen?
Mai: Nein.
Thomas Buchmann: Nein.
Sina Peschke (Radio MDR): Dann sind wir jetzt sozusagen unter uns. Aber ich kann Ihnen empfehlen, wenn sie Gelegenheit haben, sich diesen Film irgendwann mal anzuschauen. Es lohnt sich wirklich, gerade vor dem Hintergrund #metoo, um sich ein Bild zu machen, was in diesem Fernsehsender damals alles abgegangen ist.
Antje Passenheim: Er ist sehr amerikanisch, aber nachvollziehbar.

Radio: Welche Rolle spielt denn diese #metoo Debatte mit allem, was dazugehört im Privatleben der Amerikaner?
Antje Passenheim: Im Moment leider keine. Und ich muss auch sagen Amerikaner gehören nicht allgemein, aber im groben nicht zu den Menschen, die im Privatleben viel über solche intimen Sachen offen diskutieren. Das ist nicht gang und gäbe.
Aber natürlich wurde die Debatte wachgehalten. Wir haben ja gesehen, was es für ein öffentliches Interesse an diesem Prozess, wie viele Trauben von Menschen da jeden Tag davor waren, wie das in der Presse widergespiegelt wurde. Es gab ein enormes Echo über ganze Amerika hinweg. Vom Osten bis hin zum Westen, wo der nächste Prozess stattfindet.
Zwei Sachen haben diese Debatte überlagert. Das eine ist Covid. Der Virus hat leider im Moment das #metoo Thema völlig überlagert. Darüber spricht man im Moment hier nicht mehr. Auch der dritte Geburtstag des Hashtags spielt eigentlich keine Rolle in der Öffentlichkeit.
Davor warnt auch immer wieder der UN Generalsekretär Guterres, dass Corona die Rechte von Frauen jetzt auch nicht gestärkt hat. Denn die Isolierung, in die viele gekommen sind, die Arbeitslosigkeit durch die wirtschaftliche Not, das bringt viele Frauen in ganz schlimme Situationen.
In vielen Ländern der Welt kommt häusliche Gewalt wieder als Thema nach vorne. Weiger #metoo, sondern die allgemeine sexuelle Gewalt gegen Frauen. Dann ist noch eine zweite Sache hier in Amerika sehr lebendig gewesen. Das waren in den vergangenen Monaten die Proteste gegen Rassismus und Gewalt.
Auch da sagt die Mitgründerin von #metoo, Tarana Burke, das die beiden Debatten: #metoo und #blacklivesmatter miteinander verwandt sind. Die Muster sind dieselben. Sexuelle Gewalt, rassistisch motivierte Gewalt, das sind dieselben Muster. Das ist systemisch.
Das kann alles nur durchbrochen werden, wenn sich generell in der Gesellschaft etwas ändert.

Sina Peschke (Radio MDR): Ich möchte kurz auf eine Studie verweisen. Und zwar eine Studie der Wirtschaftswissenschaftlerin Lian Edwater und Rachel Sturm aus dem vergangenen Jahr.
In dieser Studie gab einer von fünf männlichen Befragten an, dass er ungern unattraktive Frauen einstellt. Jeder vierte männliche Teilnehmer der Untersuchung gab an, ein Treffen unter vier Augen mit weiblichen Kollegen zu meiden.
Was ist damit erreicht? Haben wir uns damit vielleicht auch ein Stück weit selbst ein Bein gestellt?
Antje Passenheim: Ich würde sagen, zum Teil haben wir das. Das beinhaltet auch der zweite Teil der #metoo Debatte, dass wir uns alle fragen müssen, wie weit gehen wir, bevor es unnatürlich wird.
Inwieweit provozieren wir zum Teil auch egal, ob männlich oder weiblich, Reaktionen heraus, die dazu führen, dass es zu sexueller Belästigung kommt, ohne dass wir es wissen und ohne dass uns das bewusst ist.
Das ist die zweite Frage, wo viele sagen, dass wir aufpassen müssen, dass wir dadurch keine "Über Political Correctness" erzeugen, die es uns nicht mehr möglich macht, normal miteinander umzugehen.
Radio: Da reden wir später bzw. im zweiten Teil noch einmal ganz ausführlich darüber. Frau Brandt, wie ist das in ihrem Verantwortungsbereich? Haben sie so was schon mal gespürt, dass Männer so reagieren könnten?
Jana Brandt: Ja, ganz am Anfang, als wir, was ich vorhin beschrieb, wie wir darüber diskutiert haben, wie wir miteinander arbeiten wollen, erinnere ich mich an mehrere Meetings, wo Männer einerseits versuchen, damit spielerisch umzugehen. Wie sie sich Frauen gegenüber verhalten wollen als eine Art Provokation.
Im Gegensatz aber andererseits zu einem echten Prozess des Fragens kommen, wo sie definieren. Das fängt ja bei ganz willkürlichen Themen an: Wie und wo soll ich mich hinsetzen? Wie ergeben sich Sitzordnungen?
Es sind manchmal wirklich die ganz klein Themen, die schon Machtverhältnisse klarmachen können. Wer gibt wann wem das Wort. Das Thema gipfelt im sexuellen Missbrauch, ist aber in vielen Schattierungen sehr vielfältig.
Und ja, da habe ich eine gewisse Unsicherheit bemerkt. Wo wir, glaube ich aber weit entfernt von sind, dass wir politisch zu korrekt werden. Ich würde uns als Frauen eher weiterhin dazu ermutigen wollen, sehr direkt und klar zu formulieren, wie wir betrachtet werden wollen und wie wir möchten, dass mit uns umgegangen wird. Nämlich auf Augenhöhe.
Sina Peschke (Radio MDR): Aber ganz im Ernst, wenn sie dann so verunsicherte Männer vor sich haben. Denn so was gibt es ja auch. Hatten Sie schon mal ein Moment von Mitleid?
Jana Brandt: Nein. Das ist eine Vokabel, die mir diesbezüglich nicht einfällt. Ich war auch in dem Jahr in Los Angeles unterwegs. In der Zeit, als es die Kunde machte: “Geh als Mann, nie mit einer Frau in einen Fahrstuhl, weil du weißt nie, was danach über dich erzählt wird.”
Radio: Aber muss man Männer da nicht auch ein bisschen verstehen?
Jana Brandt: Ich verstehe Männer ehrlich gesagt immer und überall. Aber wir sind alle “humanbeings” und Mitleid finde ich das falsche Wort. Ich glaube, dass wir das alles miteinander lernen müssen, wie wir unverkrampft auch weiterhin umgehen müssen.
Meine Beobachtung ist eher, dass uns Corona ein bisschen hilft. Weil die Filmbranche sehr speziell mit Umarmungen, Küsschen hier, Küsschen da sind, die vielleicht auch manchmal falsch zu interpretieren sind.
Dieser Virus bedingte Abstand kann da eine andere Realität hereinbringen. Vielleicht nicht die beste, aber zumindest in dieser Frage ganz hilfreich, weil man auf Abstand steht.
Sina Peschke (Radio MDR): Frau Nguyen, sie wollten auch noch was zu dem Thema sagen?
Mai Nguyen: Ich würde gern beim Thema Political Correctness noch mal einsteigen. Finde es immer sehr spannend, weil das ist tatsächlich auch ein Thema, was immer wieder aufkommen, wenn ich mit Menschen spreche, ganz besonders eben mit Männern.
Ich finde es ganz spannend dabei das Bild von einem Pendel zu benutzen. Ganz am Anfang bei der Umfrage mit sehr großen Bandbreite haben wir auch gehört, dass es Zeiten gab, wo einer Frau bei der Begrüßung an den Hintern gegriffen wurde und ein mehr oder weniger nettes Kompliment bekommen hat.
Sina Peschke (Radio MDR): Ich kann mich an die Zeiten auch genau erinnern, das war genau so.
Mai Nguyen: Genau und da war der Pendel lange Zeit in die eine Richtung gespannt, wo wir nicht so achtsam mit unseren körperlichen Grenzen waren. Jetzt schlägt das Pendel in das andere Extrem, wo erst mal alle unsicher sind.
Das ist erst einmal neu. “Muss ich jetzt irgendwie aufpassen? Was mach ich denn jetzt genau?” Unsicherheit schafft Fragen wie: “Mach ich Witze drüber? Wie gehe ich jetzt damit um?”
Das Spannende dabei finde ich jetzt, das Pendel in der Mitte zu sehen. Also die Balance wiederzufinden. Das entsteht durch Gespräche. Genau was die Frau Brandt gerade auch gesagt hat: In dem Moment, wo man sich fragt, miteinander spricht und rausfindet, was denn in Ordnung ist.
Wo die Grenzen sind, was der Konsens ist und was okay bei der Begrüßung ist. Dort finde ich, entsteht der neue Raum, der jetzt gerade wachsen darf.
Sina Peschke (Radio MDR): Wie Männer sich fühlen, nach drei Jahren metoo-Bewegung dazu haben wir eine Umfrage gemacht, die wir im zweiten Teil lesen.
Wenn du die Diskussionsrunde weiter lesen wollt, schau in den zweiten Teil rein. Dort kommt Christina Stockfisch vom Deutschen Gewerkschaftsbund dazu, sie ist dort zuständig für europäische und internationale Gleichstellungspolitik.
Sie definiert für uns in diesem Teil, was alles zu Belästigung gehört. Wie viele Missbrauchsopfer sich letztendlich wehren und wie hoch die Rate ist an Unternehmen, die nicht wissen, zu was sie verpflichtet sind.
Außerdem sexuelle Belästigung zu früheren Zeiten. Sitzen Frauen heute am längeren Hebel? Wie sich das Verhalten von Kindern nach einem sexuellen Missbrauch verändert und wie Eltern ihrem Kind anmerken, das etwas nicht stimmt.
Welche präventiven Vorkehrungen in Sportvereinen eingesetzt werden können, um aller Art sexuellen Missbrauch zu verhindern und was es für Vorfälle gibt, erzählt Thomas Buchmann. #metoo in Hollywood, der Harvey Weinstein Fall, der noch lange nicht vorüber ist. All das und mehr Tipps für Missbrauchsopfer und ob wir uns in die richtige Richtung bewegen im zweiten Teil.
Bis bald! Deine Mai 💛
P.S. Fandest du den Artikel hilfreich? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mich dabei unterstützt, dass die Blog- und Podcastinhalte weiterhin kostenlos bleiben. Erfahre hier, wie du mit nur 6€ im Monat zum*zur Unterstützer*in werden kannst.
Hi, ich bin Mai 😊 Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht Opfern sexuellen Missbrauchs zu zeigen, dass sie nicht alleine sind. Auch wenn eure Scham und Angst etwas anderes erzählen: Das ist nicht wahr! Und es kommt noch besser: Der richtige schöne Teil eures Lebens liegt noch vor euch! Ich habe es geschafft, aus dem schlimmsten Erlebnis meines Lebens, eine enorme Kraft zu ziehen & mein Leben nach meinen Ideen neu zu gestalten - also kannst du das auch! Deine Mai 💛
Sitzung abgelaufen
Bitte melde dich erneut an. Die Anmelde-Seite wird sich in einem neuen Tab öffnen. Nach dem Anmelden kannst du das Tab schließen und zu dieser Seite zurückkehren.